Viele Unternehmen sammeln heute mehr Recruiting-Kennzahlen als je zuvor … und trotzdem treffen keine besseren Entscheidungen.
Im letzten Insight haben wir die wichtigsten klassischen KPIs vorgestellt, die Effizienz und Qualität sichtbar machen (Foxio 2025). Doch Zahlen wie Time-to-Hire oder Cost-per-Hire bleiben häufig isoliert. Ohne Verbindung zu Performance- und Experience-Daten entsteht nur eine Scheintransparenz. Deloitte zeigt, dass Unternehmen mit integrierten HR-Analytics 2,5-mal bessere Talententscheidungen treffen (Talentbusinesspartners 2023). Die Botschaft ist klar: Nicht die Menge der Zahlen zählt, sondern welche Daten verknüpft und gedeutet werden.
Von der Messung hin zur Steuerung: Der nächste Schritt nach den klassischen KPIs
Klassische Recruiting-Kennzahlen wie Time-to-Hire, Cost-per-Hire oder die Applicant-to-Hire-Ratio sind inzwischen in vielen Unternehmen etabliert. Sie schaffen Transparenz über Geschwindigkeit, Kosten und Prozessqualität und sie waren das Thema unseres letzten Artikels. Doch wer beim Reporting stehen bleibt, bleibt im Operativen stecken. Der entscheidende Schritt besteht darin, Kennzahlen als Steuerungsinstrumente zu begreifen und sie mit weiteren Datenquellen zu verbinden.
McKinsey spricht in diesem Zusammenhang von einem „Return on Talent“: Organisationen, die Talentdaten aktiv nutzen, erzielen signifikant bessere Geschäftsergebnisse (McKinsey 2024). Es reicht also nicht, zu wissen, wie lange eine Stelle unbesetzt bleibt – entscheidend ist, welche Wertschöpfung in dieser Zeit verloren geht. Genau hier setzen datengetriebene Recruiting-Ansätze an: Sie kombinieren Effizienzkennzahlen mit Leistungs- und Produktivitätsdaten, um zu zeigen, welche Besetzungen echten Mehrwert liefern.
Auch in Deutschland zeigt sich ein Wandel. Die DGfP-Benchmarkstudie von 2023 belegt, dass Unternehmen zunehmend mehr Recruiting-Daten erheben – doch die Nutzung bleibt stark auf Basis-KPIs fokussiert (DGfP 2023). Der Schritt zur Verknüpfung mit Qualitäts- und Experience-Daten steht vielerorts noch aus. Damit verpassen Unternehmen die Chance, aus Zahlen echte Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Die zentrale Botschaft: Data-Driven Recruiting bedeutet nicht, mehr Zahlen zu sammeln, sondern bessere Fragen an Daten zu stellen. Welche Kanäle liefern langfristig performante Kandidat:innen? Welche Prozessschritte führen zu Abbrüchen? Und welche Rolle spielt die Candidate Experience für Retention und Arbeitgebermarke? Wer Kennzahlen nicht nur misst, sondern systematisch interpretiert, baut den Brückenschlag zwischen Effizienz, Qualität und Zukunftsfähigkeit.
Neue Datenebenen im Recruiting
Wer Recruiting heute datengetrieben steuern will, darf sich nicht auf Basisgrößen wie Zeit und Kosten beschränken. Diese liefern zwar eine erste Orientierung, blenden aber entscheidende Faktoren aus. Moderne HR-Analytics öffnen zusätzliche Datenebenen, die tiefer blicken lassen – und damit deutlich näher an der Realität des Recruiting-Erfolgs sind.
Ein Beispiel sind Funnel-Daten. Sie zeigen, an welchen Stellen im Bewerbungsprozess Kandidat:innen abspringen. Bricht ein Großteil zwischen Bewerbung und Interview ab, weist das auf mangelnde Kommunikation oder zu lange Wartezeiten hin. Hohe Drop-off-Raten kurz vor Vertragsabschluss deuten dagegen auf fehlende Passung oder unattraktive Angebote hin. Solche Informationen machen sichtbar, wo Prozesse wirklich haken – und liefern Ansatzpunkte für konkrete Optimierungen.
Ein zweiter Hebel ist die Offer Acceptance Rate. Sie misst, wie viele unterschriebene Verträge auf ausgesprochene Angebote folgen. Bleiben die Werte niedrig, ist das ein deutliches Signal: Entweder stimmt die Employer Value Proposition nicht, oder Konkurrenzangebote sind überzeugender. Deloitte weist darauf hin, dass Unternehmen mit integrierten HR-Daten deutlich bessere Einstellungsentscheidungen treffen und solche Kennzahlen gezielt nutzen, um Angebotsstrategien zu schärfen (Talentbusinesspartners 2023).
Ebenfalls oft unterschätzt: die Cost of Vacancy. Sie macht sichtbar, wie teuer unbesetzte Stellen tatsächlich sind – nicht nur in Form von Opportunitätskosten, sondern auch durch steigende Belastung bestehender Teams. McKinsey betont, dass Unternehmen, die diese Daten systematisch tracken, Produktivitätsverluste vermeiden und gezielter gegensteuern können (McKinsey 2024).
Diese zusätzlichen Datenebenen führen vor Augen: Recruiting darf nicht nur an Geschwindigkeit gemessen werden. Erst wenn Effizienz- und Funnel-Kennzahlen, Angebotsquoten und Kosten offener Stellen zusammengedacht werden, entsteht ein klares Bild, welche Hebel im Recruiting wirklich zählen.
Qualitäts- und Experience-KPIs: Die zweite Datenebene
Effizienz ist nur die halbe Wahrheit. Wer Recruiting rein an Geschwindigkeit und Kosten misst, blendet weiterhin zentrale Erfolgsfaktoren aus: die Qualität der eingestellten Personen und ihre Erfahrungen im Prozess. Genau hier setzt die zweite Datenebene an – Qualitäts- und Experience-KPIs.
Ein Kernindikator ist die Quality of Hire. Sie zeigt, ob neue Mitarbeiter:innen tatsächlich die gewünschte Leistung bringen und langfristig bleiben. Bewertet werden kann dies durch Zielerreichung, Feedback von Führungskräften oder Retention nach sechs bis zwölf Monaten. Es hat sich gezeigt, dass Unternehmen, die diese Daten systematisch erfassen, signifikant produktiver sind (McKinsey 2024). Qualität bedeutet damit nicht nur kulturelle Passung, sondern einen handfesten wirtschaftlichen Wert.
Eng damit verbunden ist die Retention Rate. Gerade die Frühfluktuation – also Abgänge in den ersten Monaten – macht sichtbar, ob Erwartungen im Recruiting-Prozess realistisch kommuniziert wurden. CareerTeam verweist unter Bezug auf Gallup (2024) darauf, dass Kandidat:innen mit positiver Candidate Experience dreimal häufiger langfristig zufrieden im Job sind (CareerTeam 2025). Qualität und Erfahrung sind somit untrennbar verknüpft.
Besonders ins Gewicht fällt die Candidate Experience selbst. Die BCG-Studie von 2023 belegt, dass über 50 % der Bewerber:innen ein Angebot ablehnen, wenn sie im Prozess eine negative Erfahrung machen (BCG 2023). Feedbackschleifen, Kommunikation und Transparenz sind also nicht bloß „weiche Faktoren“, sondern harte Kennzahlen mit messbarem Einfluss auf den Recruiting-Erfolg.
Diese Qualitäts- und Experience-Daten erweitern den Blick: Sie zeigen, dass Recruiting nicht an der Vertragsunterschrift endet. Wer Kandidat:innen zufriedenstellt und den kulturellen Fit sicherstellt, reduziert Fluktuation, stärkt die Arbeitgebermarke und verbessert gleichzeitig die Performance. Die zweite Datenebene macht sichtbar, ob Effizienz auch in nachhaltigen Erfolg übersetzt wird.
HR Analytics in der Praxis: Von Reporting zu Predictive Insights
Entscheidend beim Data-Driven Recruiting ist, wie Informationen genutzt werden, um künftige Entscheidungen zu verbessern. Genau hier setzt HR Analytics an: von der rückwärtsgerichteten Auswertung hin zu vorausschauenden Prognosen.
Wie bereits erwähnt, zeigt Deloitte auf, dass Unternehmen mit integrierten HR-Daten 2,5-mal bessere Talententscheidungen treffen als Organisationen ohne diese Analysefähigkeiten (Talentbusinesspartners 2023). Statt lediglich vergangene Werte wie Time-to-Hire zu betrachten, nutzen sie prädiktive Modelle, die Abbruchquoten im Funnel, Frühfluktuation oder die Wirksamkeit einzelner Kanäle vorhersagen. Damit wird Recruiting von einer reaktiven Funktion zu einem strategischen Steuerungsinstrument.
Ein praktisches Beispiel ist die Analyse der Drop-off-Rates entlang der Candidate Journey. Werden Muster sichtbar – etwa hohe Abbrüche nach dem Erstgespräch – können Unternehmen gezielt Prozesse anpassen. Auch die Vorhersage von Retention durch die Kombination aus Candidate-Experience-Daten und Performance-Indikatoren gewinnt an Bedeutung. So lassen sich Risiken früh erkennen, bevor Fehlbesetzungen teuer werden.
Analytics darf nicht nur im Reporting verankert werden, sondern muss in den Entscheidungsprozess selbst integriert werden. Das bedeutet: HR und Fachbereiche brauchen Dashboards, die Kennzahlen verständlich aufbereiten, Szenarien durchspielen und Entscheidungsalternativen sichtbar machen.
Die Konsequenz: Unternehmen, die HR Analytics nutzen, verschieben den Fokus von reinen Effizienz-Berichten hin zu strategischen Vorhersagen. Sie erkennen früh, welche Kanäle nachhaltige Qualität liefern, wo Kosten aus dem Ruder laufen – und wie sich Kultur und Experience auf die Produktivität auswirken. Damit wird Recruiting nicht nur schneller oder günstiger, sondern planbarer.
Best Practices 2025: Daten nutzen statt sammeln
Viele Unternehmen stehen heute vor derselben Herausforderung: Sie verfügen über eine Vielzahl von Recruiting-Kennzahlen, aber nur wenige schaffen es, diese Daten systematisch in bessere Entscheidungen zu übersetzen. Best Practices aus 2025 zeigen, wie ein datengetriebener Ansatz in der Praxis gelingt.
Ein zentrales Element ist die Verknüpfung von Effizienz- und Qualitätsdaten. Wer Time-to-Hire und Cost-per-Hire isoliert betrachtet, übersieht schnell, dass Geschwindigkeit nicht gleichbedeutend mit Nachhaltigkeit ist. Erfolgreiche Unternehmen kombinieren diese Basis-KPIs mit Retention-Daten oder Candidate-Experience-Scores, um zu verstehen, ob schnelle Besetzungen auch langfristig tragen.
Ein zweiter Erfolgsfaktor liegt in der systematischen Messung der Candidate Experience. Die BCG-Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der Kandidat:innen ein Angebot ablehnt, wenn sie im Prozess schlechte Erfahrungen machen (BCG 2023). Führende Unternehmen erfassen deshalb kontinuierlich Feedback – etwa über Candidate-NPS oder strukturierte Interviews – und nutzen diese Daten, um Prozesse konsequent anzupassen.
Drittens setzen Vorreiter auf Predictive Analytics. Unternehmen, die Talentdaten vorausschauend auswerten, sind deutlich produktiver (McKinsey 2024). Dazu gehören Modelle, die die Wahrscheinlichkeit von Frühfluktuation berechnen oder den ROI verschiedener Kanäle sichtbar machen. Damit wird Recruiting von einem Kostenfaktor zu einem klar messbaren Werttreiber.
Schließlich spielt die Integration in die Unternehmenskultur eine höchstwichtige Rolle. CareerTeam verweist auf Gallup-Daten, wonach Kandidat:innen mit positiver Experience dreimal häufiger langfristig zufrieden im Job sind (CareerTeam 2025). Erfolgreiche Organisationen nutzen diese Erkenntnis, um Recruiting-Daten nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit Kultur- und Engagement-Daten zu betrachten. Recruiting wird so zum Frühindikator für Arbeitgeberattraktivität.
Das Muster ist erkennbar: Erfolgreiche Unternehmen sammeln nicht einfach Daten, sie handeln danach. Sie schaffen klare Verantwortlichkeiten, stellen Tools für HR und Fachbereiche bereit und verankern eine datengetriebene Haltung.
Fazit
Die Diskussion um Recruiting-Kennzahlen beginnt meist bei Effizienz: Wie schnell und wie günstig lassen sich offene Stellen besetzen? Doch wer an dieser Stelle stehen bleibt, übersieht die eigentliche Kraft datengetriebener Steuerung. Data-Driven Recruiting verbindet klassische KPIs mit neuen Datenebenen – von Funnel-Analysen über Candidate-Experience-Scores bis hin zu prädiktiven Modellen.
Die Studien zeigen ein klares Bild: Unternehmen, die ihre Recruiting-Daten systematisch nutzen, sind produktiver, treffen bessere Einstellungsentscheidungen und sichern sich langfristig zufriedenere Mitarbeiter:innen. Recruiting wird damit nicht nur schneller und kosteneffizienter, sondern auch planbarer und kulturell aussagekräftiger.
Für Entscheider:innen bedeutet das: Der nächste Schritt besteht nicht darin, noch mehr Kennzahlen zu sammeln, sondern die richtigen Daten gezielt zu verknüpfen – und sie in konkrete Steuerungsinstrumente zu übersetzen. Wer das schafft, stellt Recruiting als strategische Funktion auf. Und genau das macht den Unterschied aus in Zeiten von Fachkräftemangel und knappen Budgets.
Möchten Sie Ihre Recruiting-Prozesse präziser steuern – und dabei sowohl Qualität als auch Candidate Experience sichern? Foxio unterstützt Sie dabei, ein passendes KPI-Set aufzubauen und datenbasierte Entscheidungen in die Praxis zu bringen. Mit analytischem Verständnis, technischer Expertise und einem geschärften Blick für moderne Recruiting-Prozesse.
Lassen Sie uns gemeinsam die entscheidenden Stellschrauben identifizieren – und das volle Potenzial Ihrer Recruiting-Daten ausschöpfen. Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Quellen
- BCG (2023): What Job Seekers Wish Employers Knew.
- CareerTeam (2025): Candidate Experience ist Unternehmenskultur in Echtzeit
- DGfP (2023): Recruiting-Benchmark-Studie.
- Talentbusinesspartners (2023): How Top Companies Use Recruitment Analytics.
- Foxio (2025): Effizienz trifft Qualität – Welche KPIs Ihr Recruiting wirklich voranbringen.
- McKinsey (2024): Increasing your return on talent: The moves and metrics that matter.
Zum Weiterlesen
Wie Sie Ihre Recruiting-Prozesse datenbasiert aufstellen und technisch optimieren, zeigen wir im vorherigen Insight „Data-Driven Recruiting – Die Schlüsselstrategie zur Kostensenkung im Personalwesen“. Dort geht es um Tools, Automatisierung und den Aufbau einer echten Datenstrategie.



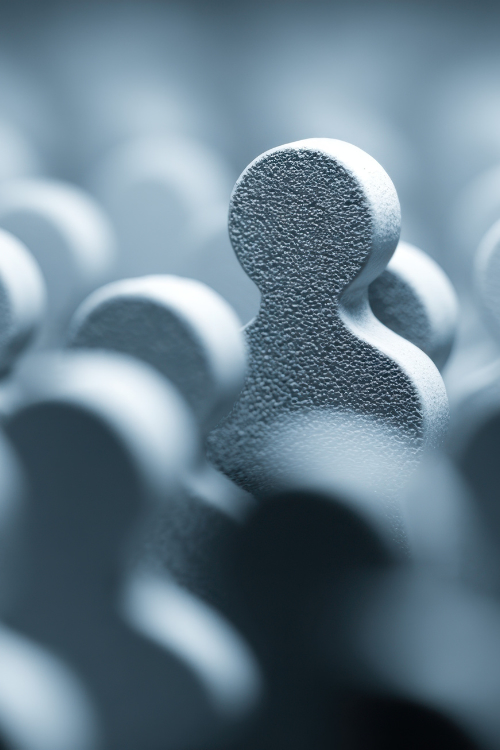








.png)



